Der als scharfsinnig bekannte Züricher Religionsphilosoph und Theologe Ingo u. Dalferth, legte im Jahr 2008 eine Hermeneutik des Bösen vor, die die gängige Bearbeitungen dieser komplexen Thematik an historischer Kenntnis und präziser Interpretation um ein Weites überbietet. Als Grundlagenwert sollte diese Monographie in jeder philosophsichen und theologischen Bibliothek stehen.
Besprechung von
Ingo U. Dalferth, Malum: Theologische Hermeneutik des Bösen, Tübingen 2008, 593 Seiten
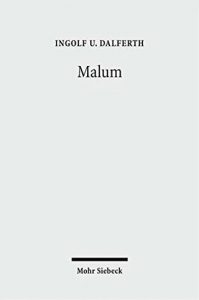
Die Abhandlung hat einen Umfang von nahezu 600 Seiten, obwohl die Fragestellung eng umgrenzt ist. Doch ein Systematiker von hohen Graden ist am Werk. Es ist die letzte von insgesamt drei Studien, die Dalferth (D.) in den vergangene Jahren vorgelegt hat. Die Vorgängerinnen zur Sinngeschichte des Bösen[1] sowie zur Frage des Umgangs mit ihm[2] sind erheblich kürzer geraten. Gemäß Untertitel erhellt D. in der vorliegenden Studie die „hermeneutischen Operationen, mit denen Menschen im Rekurs auf Göttliches, Götter oder Gott auf Böses und Übel in ihrem Leben reagieren“ (S. VII). D. hat die Menschen des westlichen, christlich geprägten Kulturraums im Blick. Die Studie ist in drei Teile gegliedert; das Schwergewicht liegt in Teil II. Die Einteilung dieser Rezension gleicht sich der Gliederung der Studie an.
Teil I (Böses als Problem, S. 1-98)
bestimmt einleitend das Böse als Orientierungsformel für eine breite Palette von Erfahrungen. D. schafft Klarheit in den Begriffen und Bedeutungsschichten. Das Böse zielt auf die Ebene des Widerfahrnisses selbst, der Erfahrung sowie des Verstehens (19f.). Der Begriff, beschreibend oder in bewertend eingesetzt, fungiert immer innerhalb bestimmter Konzeptionen, denen D. möglichst umfassend nachgeht. Aporien finden sein Interesse. Er sieht selbst die traditionellen christlichen Antworten als Umwege, die nie als als „theologische Gebrauchsanweisung“ dienen können. Zum Verstehen des Sinnlosen gibt es keine Methode. Doch sieht er diese Antworten als „Ausweg“, um angesichts des Bösen zu leben, ohne selbst im Bösen zu versinken“(98). Damit fällt der Theologie als solcher eine hermeneutische Aufgabe zu, die das Böse zwar ernstnimmt, ihm im Blick auf Gott aber seinen Ort zuweist.
Teil II (Das Böse denken, S. 99-517),
Herzstück der Arbeit, folgt einem klassisch protestantischen Schema, nämlich der kosmologischen, der moralischen und der streng theologischen Deutung. Die christliche Tradition dachte das Böse als Beraubung, als Übeltat und als Unglaube.
Teil II, 1 (Privatio Boni, S. 123-217)
greift die lange Denkgeschichte (Aristoteles, Plotin, Augustinus) auf und arbeitet deren kosmologisch-metaphysische Perspektive heraus. Dies geschieht in hochdifferenzierten Analysen (als Negation, Privation, Besitzverlust, Abwesenheit, Störung von Leben und Zusammenleben), im Blick auf lebensweltliche Hintergrundorientierungen (S.124 –140) und in neu weiterführenden Leitlinien (142-145), die Plotins Leistung kritisch beleuchten. Augustinus übernimmt Plotins Konzept in monistischer Abwehr allen Dualismus. D. begegnet Augustins Lösung kritisch (158). Obwohl er ihn gegen „oberflächliche Kritik“ verteidigt.
Dem Privationsgedanken ist das neuzeitliche Theodizeeprojekt eng verflochten (160-213). Gottes Vorsehung gerät durch P. Bayle in die Kritik. Darauf reagiert G.W. Leibniz, dessen Analysen in der theologischen Literatur ihresgleichen suchen. Auch hier stellt D. erst die innere Kohärenz des Entwurfs heraus, bevor er sie einer Kritik unterwirft. Wichtig sind für D. die komplizierte Ausgangslage von Leibniz’ Argumentation, also sein gleichzeitiges Festhalten (1) an Vernunft und Güte der Welt, (2) an Gottes unbedingtes Güte sowie (3) an der Existenz des Bösen. Leibniz müsse nachdrücklich zwischen metaphysischem, physischem und moralischem Übel unterscheiden; die Welt beschreibe er als harmonische Übereinstimmung von Zweck- und Wirkungszusammenhang (178). Menschen sind wesentlich unvollkommene Wesen (192);: dieses „metaphysische“ Übel ist unvermeidbar. Das Übel ist nicht der Preis der Freiheit, sondern der Preis einer notwendig endlichen Schöpfung. Jetzt erst spricht D. vom Kernpunkt in Leibniz’ Konzeption, nämlich dem metaphysischen Mangel der Schöpfung, nicht Gott zu sein. Damit übersehe Leibniz die entscheidende Perspektive: Der Mensch habe das Glück hat, zu sein, obwohl er nicht sein müsste und nicht sein könnte.“ (209) Doch verabschiede es sich nicht „um vermeintlicher praktischer Abkürzungen willen“ von Gott (213).
Teil II, 2 (Malefactum, S. 219-298)
wendet sich dem Verstehensansatz der Übeltat zu. Wieder ist D. in seinem Element mit zahlreichen Differenzierungen zwischen Wille und Tat, menschlicher Freiheit und ständiger Selbstbindung, dem möglichen und dem faktischen Willensentscheid. Augustinus lege alles Gewicht auf den bösen Willen, verdränge das Gewicht der schädlichen Tat (229), konstruiere zwischen Schuld und Strafe eine Scheinsymmetrie. Zugleich arbeitet D. die Abgründigkeit der Frage heraus: Warum bin ich überhaupt so, dass ich Böses wollen kann? (238) Zu fragen ist nach dem (für seine Übeltat) verantwortlichen Täter, dessen Situation Augustinus sündentheologisch und sucht sie soteriologisch zu lösen versucht (239). Die Frage nach Sünde und Sünder rücken ins Zentrum (242f.). Auf Genese und nähere Deutung der Ursündenlehre geht D. nur kurz ein. Sie setze eine „universalienrealistische“ Auffassung der menschlichen Natur voraus und reduziere alles Übel auf die Sünde (244f.). Mit diesen vorneuzeitlichen Konzeptionen macht D. kurzen Prozess, um dann in das Freiheitsprojekt der Moderne einzutauchen. Ein ganzer Paragraph (255-287) wird zu einer virtuosen, wenn auch monologischen Auseinandersetzung mit I. Kants Konzept vom radikal Bösen.
Wie bekannt, ersetzt Kant im Sinne Hiobs die traditionelle durch eine „authentische“ Theodizee. Sie konzentriert sich nicht auf allgemeine Fakten oder Gesetze, sondern auf unsere je eigene Situation, die von Natur und Freiheit bestimmt ist. In den Blick kommt die empfangende Vernunft, die wir Gewissen nennen, die in Erkennen und Handeln zum „Ort der Erfahrung menschlicher Freiheit“ wird (358). Der Kausalität der Naturgesetze steht die Erfahrung der Freiheit antithetisch gegenüber. Von Freiheit ist zu reden, weil es Handlungen gibt, die einen Urheber haben, ohne den es sie nicht gäbe. Autonom ist eine Person, sofern sie sich in ihrem freien Willen jeweils selbst bestimmt. Allerdings kann sie sich dann nur zum Guten oder zum Bösen bestimmen und hier beginnt das Problem. Da sich nämlich ein guter Wille nicht zum Bösen bestimmen kann, gibt es eine grundlegende Fehlbestimmung unseres Willens, sofern er sich nicht am Sittengesetz orientiert. Warum das so ist, weiß auch Kant nicht zu sagen. Dalferth kommt zu Formulierungen die zwischen Paulus, Augustinus, Luther und Kant eine tiefe Verwandtschaft signalisieren: „Wir können, weil wir sollen, aber zugleich können wir nicht, weil wir nicht wollen. Im Prinzip können wir das Gute wollen (denn wir sollen es ja), konkret aber wollen wir es gerade nicht (obwohl wir es sollten)“ (274). Also sind wir nicht einfach rationale Tiere, sondern Personen, die sich in ihrer Freiheit am Guten oder am Bösen orientieren könnten. Während für Leibniz das Böse der Schatten der Kontingenz und Endlichkeit ist, ist es für Kant der Schatten der Freiheit. Wir bleiben durch unser Gewissen bestimmt, das gegen den Widerspruchscharakter der Freiheit zu kämpfen hat; Selbstbestimmung ist nur als ein kreativer Vorgang möglich. Das Böse ist nicht der Preis der Freiheit im oft besprochenen Sinn, sondern deren äußerste Bedrohung. Kant richtet eine äußerste Grenzmarkierung auf: Wir können das Böse nicht um seiner selbst willen tun. Dalferth gibt Kant recht. Er zeigt aber auch, dass Kants aporetische Gedankenführung die Täterperspektive immer schon verkürzt hat. Die Theologie ist deshalb gut beraten, „sich ausdrücklich an der Opferperspektive zu orientieren“ (292). Sie nämlich macht deutlich, dass nicht alles Übel auf bösen Willen zurückzuführen ist. Aus der Perspektive des Opfers wird die Frage nach dem Sinn des Übels aber noch auswegloser. Dies ist für Dalferth Grund genug, zum dritten, für ihn entscheidenden Verstehensansatz überzugehen. Wieder bricht Dalferth eine höchst differenzierte und vielschichtige Verhandlung ergebnisoffen ab. Und wieder vermutet man bei ihm eine Gedankenregie, die die Katze noch nicht aus dem Sack lässt.
Teil II,3 (Das Malum als Unglaube, S. 299-517)
Hier liegt für Dalferth die eigentliche Revolution im Denken der (abendländischen) Theologie. Für die Reformation besteht das Böse nicht mehr in der freien Abwendung von Gott, sondern in der Unfähigkeit sich Gott zuzuwenden. Der Mensch sündigt, weil er faktisch nicht coram Deo lebt, also Sünder ist, nicht umgekehrt. Anders gesagt, Sünde im strengen theologischen Sinn kann nicht gutgemacht, sondern nur von Gott vergeben werden. Sünde ist also von den existentiellen Grundbestimmungen des Glaubens her zu verstehen, der in Gott alles Wirken sieht. Dalferth arbeitet diesen Ansatz breit und in theologischer Gründlichkeit aus. Er wird zum reformatorische orientierten Traktat im Traktat. Glaube und Unglaube sind keine graduellen, sondern prinzipielle Unterschiede, die sich nur von Gott her verstehen lassen und nur durch Gott in Bewegung geraten. Glaube wird durch Gottes Handeln und ist nur als ein neues Bewusstsein vor Gott verstehbar. Er zeigt sich als die Differenz, „die Gott als Schöpfer zwischen Nichtsein und Sein, Möglichem und Wirklichem … und Unglauben und Glauben … setzt.“ (329). Glaube orientiert das Verständnis der Wirklichkeit nicht mehr in der Perspektive der dritten, sondern der zweiten Person, da Gott als Du angesprochen wird und mich/uns als ein Du/Ihr anspricht. Sünde wird als Unglaube (M. Luther), als Verzweiflung (S. Kierkegaard), als Entfremdung (P. Tillich) verstanden. Der Rekurs auf Gott eröffnet eine Dimension, die allem Übeltun und Übelerleiden vorausgeht. Es ist die Entfremdung von Gott, die uns erst unsere Selbstentfremdung verstehen lässt. Wie also auf den hermeneutischen Umweg über Gott verwiesen. (352).
In diesem Paragraphen zeigen sich der Höhepunkt und die spezifisch reformatorische Wende des gesamten Traktats. In äußerst präziser Diktion zeigt sich hier auch eine Verstehensgrenze. Hier bringt Dalferth die spezifisch reformatorische Tradition in ausdrücklich distinktiver Weise ins Spiel. Sie setzt sich bewusst von der altkirchlichen Tradition ab, die sich in der katholischen Kirche erhalten hat und zwingt katholisches Denken geradezu zu einem Rückfall in antireformatorisches Denken. Ausdrücklich und wohlreflektiert distanziert sich Dalferth von einer „natürlichen Theologie“ und führt den hermeneutischen Umweg über Gott nicht als Präzisierung, sondern als Alternative ein (352).
Konsequent rekonstruiert Dalferth das Böse jetzt als „Gottesprojekt“ in der Trias von Gottes Güte, Gottes Gerechtigkeit und Liebe. Angesichts der Güte Gottes erscheint das Böse – zumal im Gefolge Platons – als das Andere des Bösen (357-399). Diese Perspektive bleibt ungenügend, denn ein als absolute Güte verstandener Gott macht die Mischung der Welt aus Gutem und Bösem, aus Ordnung und Unordnung, aus Leben und Tod, aus Glück und Unglück im Grunde unverständlich. Dies führt zum Kampf gegen das Böse, den Gott in seiner Gerechtigkeit ageht (400-448). Dieser Paragraph nun wird in noch größerer Dramatik als der vorhergehende entfaltet. Der Autor bespricht die großen Kämpfe, die sich in der hebräischen Bibel gezeigt haben. Es geht um die großen Lösungen und um deren Scheitern. Er meint das Scheitern der ersten Menschen, bis Gott der Menschheit mit Noah eine neue Möglichkeit gegeben hat. Es geht um die große Zuschreibung aller Gerechtigkeit an Gott. Aber auch sie lässt sich auf Grund der vielen Unheilsverfahrungen nicht halten. Gerade sofern Gott aktiv in die Geschichte der Menschen eingreift, wird er selbst zum Urheber des Bösen und zum Feind des Menschen. Es scheitert der Zusammenhang von Tun und Ergehen und es scheitert mit dem Hiobbuch schließlich alle Hoffung darauf, man könne das eigene Verhalten wie auch immer mit Gottes unberechenbarer und unverfügbarer Gerechtigkeit in Verbindung bringen. In Gottes Gerechtigkeit zerbrechen alle Vorstellungen, die sich Menschen von ihr machen.
Nachdem der Autor also auch in der Gerechtigkeitsperspektive nur Probleme, also keine Lösung sieht geht er zu einer dritten Perspektive über. Es ist die Liebe Gottes, die das Böse nicht durch dessen Zerstörung, sondern in kreativer und überbietender Weise überwindet (449-517). In dieser letzten thematischen Einheit zum Gottesprojekt (Teil B) kommt Dalferth als christlicher Theologe wirklich zu sich. Er führt durch die biblischen Erinnerungen, von Abraham bis zur Gemeinde Jesu. Konsequent arbeitet er die Aporien der ungezählten Geschichten und Erzählungen heraus, sei es beim „Verlässlichkeitsexperiment“ des Abraham oder bei der Gottverlassenheit Jesu. Bei beiden geraten Abraham und Jesus in den Widerspruch ihrer selbst. Aber jedes Mal führt die Erfahrung der Ausweglosigkeit zur Reinigung der ambivalenten Gotteserfahrung. In jedem Fall zeigt sich, worauf es in Gott ankommt: Auf eine Liebe, die alle Berechnung sowie alle Zerstörung übersteigt. Jetzt endlich zeigt sich, was Dalferth mit dem „hermeneutischen Umweg über Gott“ meint (501). Es ist der Verstehensweg, der in Jesus vorgezeichnet ist, den Jesus selbst geht und von dem her allein seine Bedeutung für den Glauben sichtbar wird. Böse im entscheidenden Sinn ist alles, was die Menschen von Gottes Liebe und Leben trennt. Je besser dieser entscheidende Kern des Bösen erkannt wird, desto gelassener kann man mit den Übeln des Lebens umgehen. Nach Dalferth erleiden Christen im Leben Böses wie andere Menschen, aber sie erleiden es anders, mit einer anderen Einstellung. Denn sie beurteilen das Böse als etwas, das „nicht das letzte Wort hat“ (515).
Teil III (Orientierungsstrategien im Umgang mit dem Bösen, 519-547) Was folgt dieser herausfordernden, umfassenden, oft hochkomplizierten Denkbemühung? Dir letzte und relativ kurze Teil geht der Frage nach, wie sich Menschen angesichts des Bösen orientiert haben. Sie mussten und müssen sich orientieren, denn die Begriffe des Guten und Bösen wirken selbst schon als Orientierungsbegriffe. Dalferth geht aus von der „unerwünschten Wahrscheinlichkeit des Bösen“ und der „normalen Unwahrscheinlichkeit des Guten“ (521). Wir sind also in eine Welt verfügt, die zu unlösbaren Fragen führt. Religionen stellen sich ihrerseits die Frage, wie wir uns zu diesem Unverfügbaren in ein konstruktives Lebensverhältnis setzen können. Es geht um einen Weg, der erlaubt, „mit ihm und angesichts von ihm zu leben“ (524). Allerdings führt auch das Leben mit Göttern zu keiner Lösung. Es bleibt ja die Frage offen, an welchen der Götter ich mich in bestimmten Situationen zu halten habe. Bleibt also als sinnvoller Weg Also der heno- oder monotheistische Glaube an einen guten Gott? Auch in diesem Fall sieht Dalferth verschiedene und vielfältige Muster von Gottesbildern, die immer neu in Aporien. Für Dalferth steht die christliche Antwort als eine überzeugende am Ende: „Wer Gott liebt, liebt Gott ohne Sinn und Zweck für etwas anderes, sondern allein um der Gottesliebe willen“ (542). Damit werden die Weltprobleme nicht gelöst, aber eine immer zweideutige Welt wird in die eschatologische Hoffnung eingebracht. Der christliche Glaube hat einen kontrafaktischen Zug. Alles mündet in der Hoffnung, dass Gottes Liebe am Ende stärker ist als alles Böse. „Gott liebt das Geschöpf ins Leben – in sein Leben. Und daraus kann es durch kein Übel, das es betrifft, und kein Böses, das es zu vernichten scheint, herausfallen.“ (547)
Dalferth hat mit diesem Traktat über das Böse eine Arbeit vorgelegt, die in ihrer Dichte, und denkerischen Präzision, in ihrer Gründlichkeit und denkgeschichtlichen Tiefenschärfe ihresgleichen sucht. Umso mehr zeigen sich die Konturen eines Denkens, das einerseits von K. Barth und E. Jüngel ebenso klar profiliert ist wie von linguistischer und hermeneutischer Reflexion. Der kompromisslose Rekurs auf reformatorische Theoriebildung regt nicht deshalb zum Widerspruch heraus, weil er an sich falsch wäre. Dieses Urteil würde der Leistung des Buches in keinem Fall gerecht. Es fordert zum Widerspruch heraus, weil sich die vom Widerspruch lebenden und oft in Paradoxien formulierten Ansätze so massiv verselbständigen, dass sie dem neugierigen und lernbegierigen, aber lutherisch nicht mehr sozialisierten Leser kaum mehr verständlich sind. Ein Spitzensatz wie „….“ steht sich selbst im Wege, oder die wiederholte Suggestion, dass nur der an Gott Glaubende die Ausmaße des Bösen wirklich ermessen könne, dies erweckt allzu leicht den Eindruck der Überheblichkeit. Zwischen der Alternative von ungläubig beobachtender und christlich bekennender Haltung wird so die Frage nach einem religiösen Zugang und einer allgemein religiösen Besprechbarkeit des Problems zermahlen. Erst allmählich entdeckt der Leser, wie konsequent er sich von der verborgenen Strategie des Autoren lenken lässt. Ein jeder Themenabschnitt endet in einer Aporie, sodass sich die wahre Antworten auf das Paket der Fragen nur dem Gläubigen und Theologen erschließt. Ist es aber wirklich so, dass nur der Theologie die Welt versteht? Oder ist die Frage nach dem Bösen bei Dalferth nicht einfach die Rückseite der Frage nach Errettung und Heil? Letzteres würde verständlich machen, warum sich Dalferth bisweilen in theologischen und in christologischen Reflexionen so intensiv ergeht, als sei hier eine Gotteslehre oder eine Christologie zu entwerfen.
[1] Essay über die kulturelle Denkform des Unbegreiflichen, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, 215 S.
[2] Leiden und Böses: vom schwierigen Umgang mit Widersinnigem, Leipzig: Evang. Verl.-Anst., 2006. – 219 S.
Veröffenflicht in: Theologische Revue 105 (2009), Nr. 4, 322-325.
Letzte Änderung: 30. Juli 2017